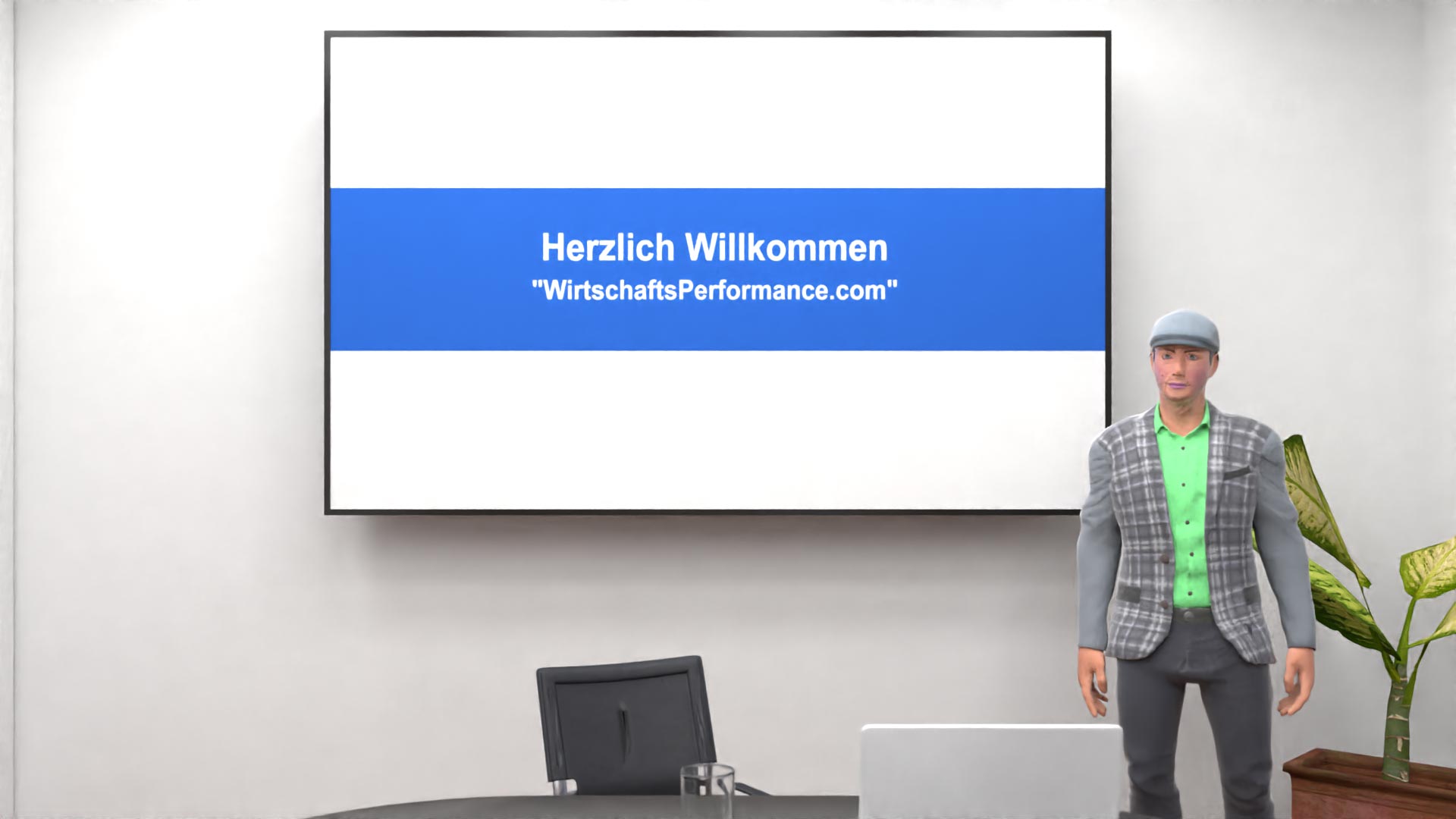
Organisationsstruktur
Asset-Risk-Management
Managementprozesse
Unterstützungsprozesse
Qualitätsmethoden
Betriebliche Managementsysteme
FMEA „Failure Modes and Effects Analysis“ oder Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
FMEDA
Zuverlässigkeitsblockdiagramm
Markov-Analyse
Vergleich der qualitativen und quantitativen Anforderung in Bezug auf die Ausfallwahrscheinlichkeit eines „top events“. Bei einer Differenz dieser Werte besteht Handlungsbedarf (Maßnahmen)
SchwachstellenfürmöglichesVersagendefinieren
Maßnahmenergreifen,umdievorgegebeneWerteerreichenzukönnen
Empfohlene Verbesserungsmaßnahmen
Um die definierten Schwachstellen zu beseitigen werden Maßnahmen vorgeschlagen,die unter Beachtung der folgenden Punkte gewichtet und bewertet wird:
Entsprechen die Berechnungsergebnisse nicht den Zielvorgaben, muss eine Analyse für das Fehlschlagen erfolgen und Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet werden
Zielsetzung und Anwendungsbereich:
Anfangs Einsatz der FTA rein zur Bewertung von Anlagen, Schaltungen etc.
Komplexe Fehlerbäume lassen sich nur unter Anwendung rechnergestützter Methoden sinnvoll behandeln
Mit zunehmender Zahl informationstechnischer Systeme ging eine zunehmende Verflechtung der FTA mit Software einher:
Software-Tools
FTA:
FMEA:
FTA:
FMEA:
Vorteile:
Nachteile:
Probleme dieser Kombination:
Erweiterung der FTA durch Einführung zusätzlicher Verknüpfungsglieder, hinter denen Markov-Modelle stehen