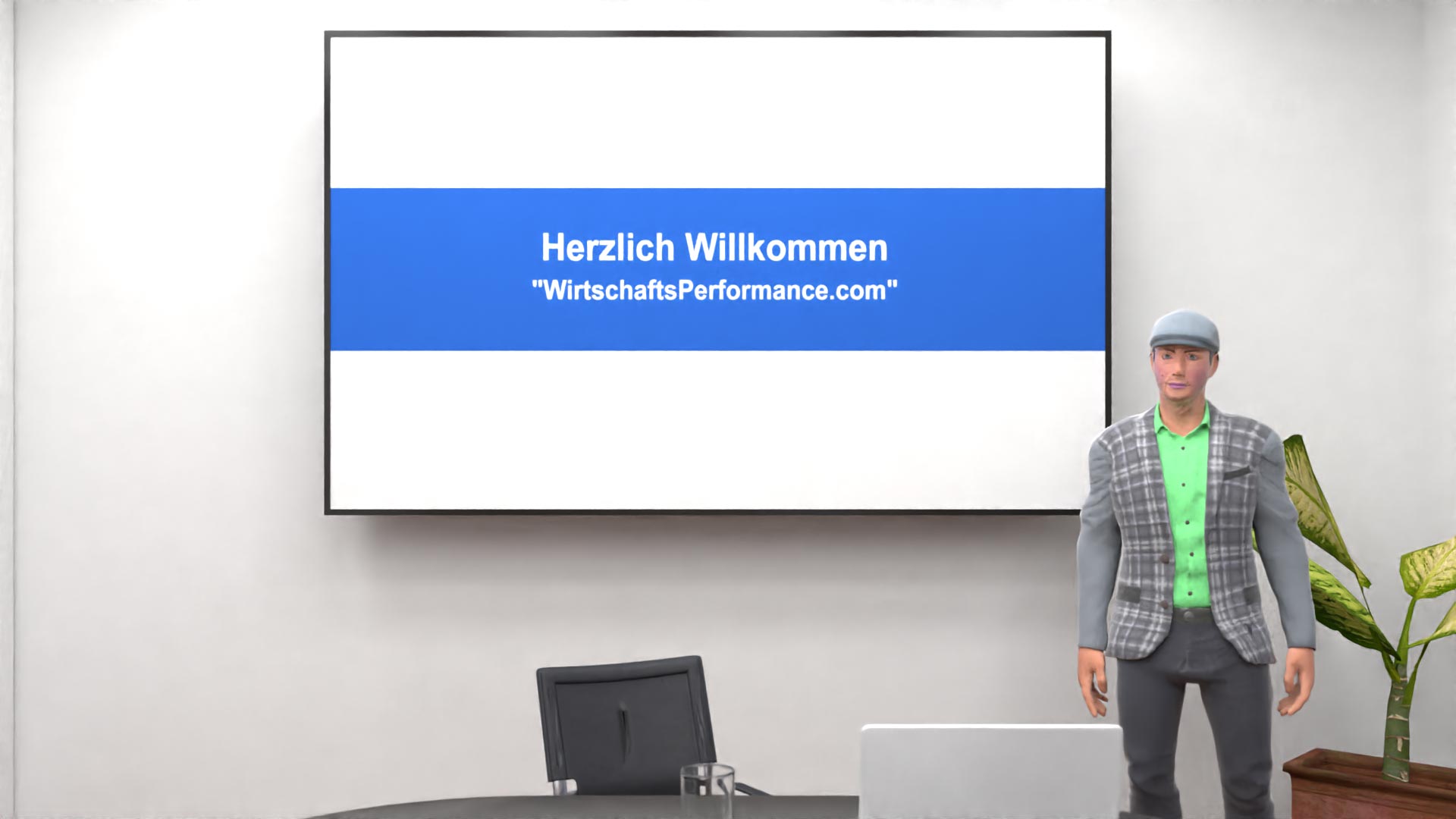
Organisationsstruktur
Asset-Risk-Management
Managementprozesse
Unterstützungsprozesse
Qualitätsmethoden
Betriebliche Managementsysteme
Überblick
Gemäß EN 61025
Bestimmung des Beta-Faktors z. B. über Check listen wie in der IEC 61508 (Werte für ß meist zwischen 0,01 bis 0,3 - gemeinsame Ressourcen, Diversität, gemeinsame CCF-Ursachen)
Nach EN 61025-2007 sind mindestens die folgenden Analyseschritte durchzuführen:
Ziel:
Vorgehen nach zwei mögliche Ansätze
Präventiver Ansatz:
Korrektiver Ansatz:
Unterschiedliche Arten von Ausfällen haben unterschiedliche Auswirkungen auf das Top-Event
Betrachtung verschiedener Arten von Komponentenausfällen:
Ermittlung des Top-Ereignis
Ausfall mehrerer gleichartiger Komponenten, die zu einem Schadenereignis führen
Die Zuverlässigkeit bzw. das Risiko von Ausfällen wird über die graphische Struktur (qualitativ) abgeschätzt
Alle Ereigniskombinationen, die zum Ausfall eines Systems führen, können gefunden werden
Voraussetzungen hierfür sind:
Kritischer Pfad = Kritische Menge bzw. minimale Schnittmenge
Kritische Menge – Schwächster Ast = ODER-Verknüpfungen
Kritische Menge – Stärkster Ast = UND Verknüpfungen
Vorteile:
Nachteile: